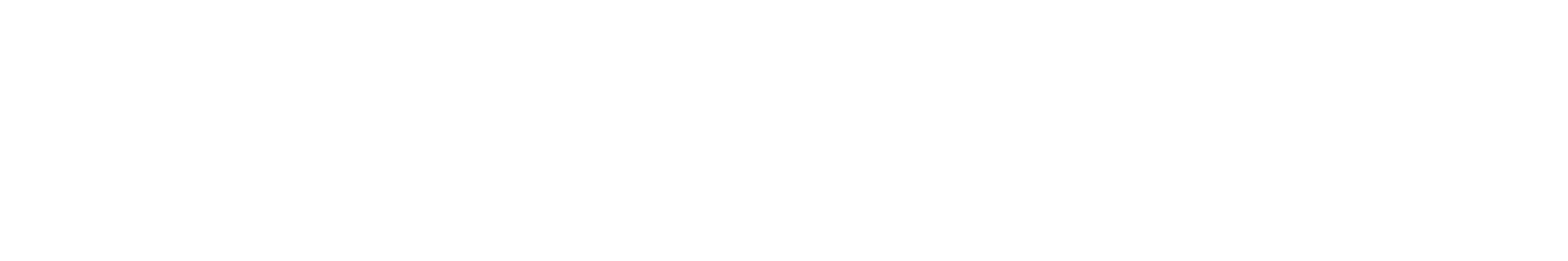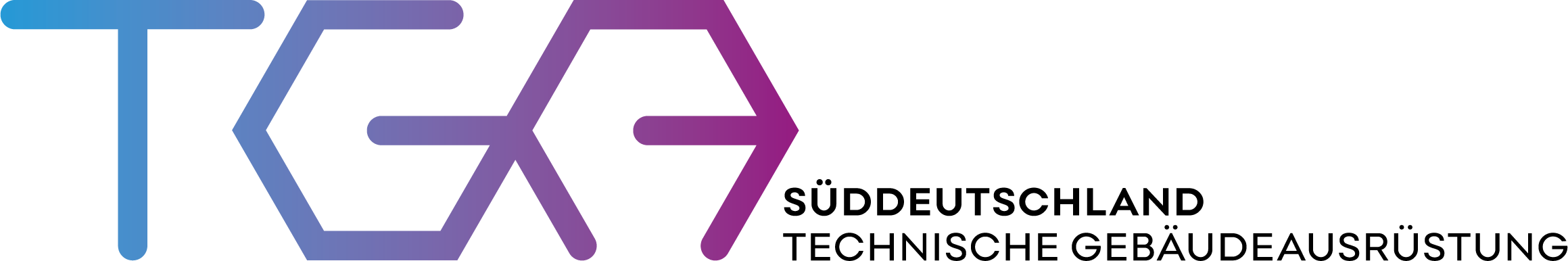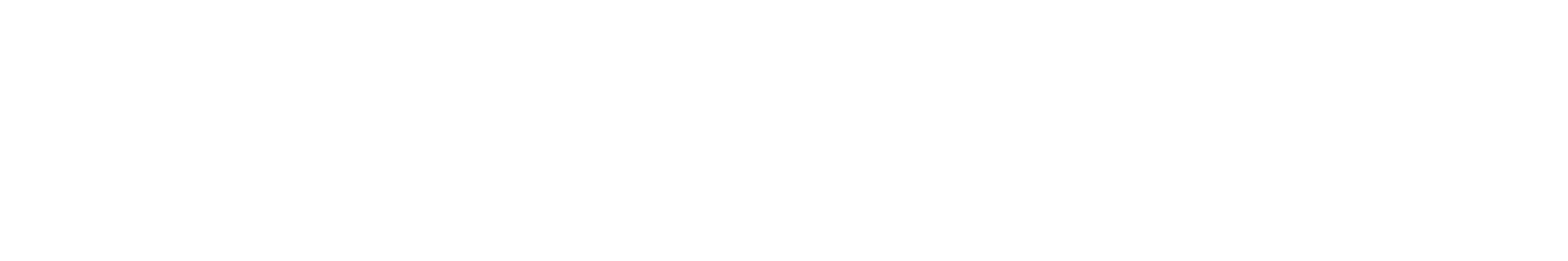Moderne Heizungstechnik setzt vermehrt auf erneuerbare Energiequellen wie Solaranlagen, Wärmepumpen und Grundwassernutzung. Innovative Ansätze wie Abwärmenutzung, Kraftwärmekopplung und Fernwärmeversorgung optimieren die Energieeffizienz. Zusätzlich sorgen Technologien wie Dampferzeugung, Bauteilaktivierung, Hybridheiz-/kühldecken und Energieböden für eine flexible Raumklimaregulierung. Diese Maßnahmen tragen zur nachhaltigen Energieversorgung und CO2-Reduzierung in Gebäuden bei.